Einleitung Schule
Was kann ich in der Schule machen?
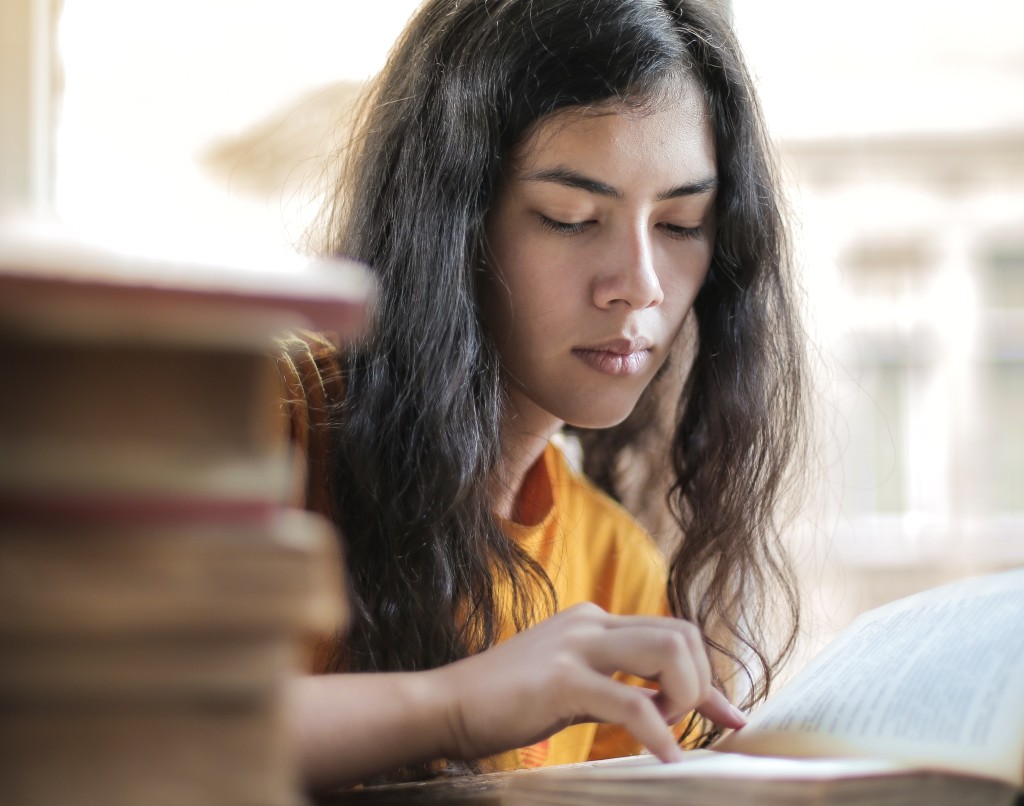
„Du bist zu deutsch!“
Für einige Schüler*innen, Lehrende, Direktor*innen und andere ist die Schule der erste oder einzige Ort, wo sie ein vielfältiges und unterschiedliches Umfeld erleben. Das ist ein reicher Boden für viele Missverständnisse – und ebenso eine wunderbare Chance für Aufklärung. Schule ist ein Ort, wo wir Geometrie und Grammatik lernen, und wir erlernen dort auch den Umgang mit anderen Menschen und wie Teamgeist entwickelt werden kann.
Schulen haben oft Richtlinien oder Vorschriften, die die zwischenmenschlichen Beziehungen regeln; nutze sie als Werkzeuge, um etwas gegen Vorurteile zu sagen. Je nach Bundesland haben manche Schulen eigene Fachkräfte für Sozialpädagogie, die Schüler*innen, deren Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte vertraulich beraten. Eventuell gibt es auch Fachkräfte für Schulpsychologie vom Bezirk, die für zugeteilte Schulen in zeitlichen Abständen offene Beratungsstunden anbieten.
Viele Schulen wissen inzwischen, dass durch Vorurteile Schaden entstehen kann, und bemühen sich, dem vorzubeugen. Möglicherweise bietet die Schule die größten Chancen, um Respekt und Toleranz zu lernen. Stelle sicher, dass deine Schule ein Umfeld bietet, das Mitgefühl, Verständnis und Vorteile von Unterschieden wertschätzt.
Druck von Ebenbürtigen („peer“) motiviert Schüler*innen häufig sehr stark – sowohl zum Positiven wie Negativen. Suche gezielt Verbündete und bemühe dich, für andere da zu sein, wenn sie deine Unterstützung suchen.
Überlege, ob du eine kurze Kampagne startest, gegen stereotype Beschimpfungen und beiläufige Abwertungen, die man auf dem Schulgelände hört.
„Ich finde das Informieren wichtig und dass man nicht durch Unwissenheit Menschen diskriminiert. Dies sollte Teil der Schulausbildung sein (eigenes Fach: Vielfalt)“
(Mann, 28 Jahre), Vielfaltsbarometer 2019 S. 91, Robert Bosch Stiftung
Erlebnisse & Inspirationen
Was kann ich bei beleidigenden Sprüchen sagen?
Erlebnisse
- „Du Spast!“ hört eine Lehrerin einer neunten Klasse häufig auf dem Schulhof. Sie spricht dann die Person an, ob sie weiß, was das bedeute. Die Antwort sei immer „So ein kleiner Vogel.“
- Es ist eine beiläufige Beleidigung, die man überall in Schulen hört „Boah, ist das schwul!“ Eine Lehrerin erzählt, wann immer sie diese Beleidigung im Klassenzimmer hört, fragt sie „Was ist daran homosexuell?“
Dann nutzt sie diesen Moment, um den Gebrauch von Slang und von entwertender Sprache in der Klasse zu besprechen, inklusive rassistischer und sexistischer Sprache. „In ihren Herzen wissen sie genau, dass sie im Unrecht sind, dieses Wort auf diese Art zu verwenden.“ sagt eine zweite Lehrerin. „Sie brauchen nur jemanden, der sie genau dort stoppt.“
- Lehrkräfte können aber auch selber diejenigen sein, die herabwürdigende Sprache verwenden. Dann sollten Schüler*innen und andere Lehrkräfte etwas sagen.
Sag was!
Lehrkräfte und Schüler*innen im ganzen Land geben an, dass sie jeden Tag vorurteils-geprägte Sprache hören: „Das ist so lahm.“ „Der ist spast.“ „Das ist so Ghetto.“ „Sie ist so psycho.“ „Er ist bipolar.“ Hier sind einige Ideen, die Flut einzudämmen:
Inspirationen
Ermittle das Ausmaß des Problems. Schüler*innen könnten als ehrenamtliche Aktivität oder innerhalb einer AG oder eines Projektes andere Schüler*innen zu vorurteilsbeladener Sprache an der Schule interviewen: Was sie am häufigsten hören, von wem sie das hören, wie sie sich fühlen, wenn sie das hören, und was sie bereit sind zu tun, um den Gebrauch zu stoppen.
Starte eine „Worte verletzen“ Kampagne. Finde einen losen Verbund von Schüler*innen, Lehrkräften, Fachkräften für Sozialpädagogie, und Verwaltungsangestellten zur Unterstützerung für eine Veranstaltung oder eine einwöchige Bildungskampagne, zu den schädlichen Folgen verletzender Worte.
Stärke Andere. Unterstütze Mediationsbemühungen. Nutze den Druck Ebenbürtiger („peer“). Bringe Schüler*innen Techniken der Konfliktbewältigung bei, und beauftrage sie, mit Peers gemeinsam daran zu arbeiten, den Gebrauch von verletzenden Worten zurück zu drängen.
Lehre Toleranz. Wenn Verunglimpfungen im Klassenzimmer geäußert werden, unterbrich was auch immer du gerade lehrst, und erkläre den Zusammenhang von Sprache, Respekt und kultureller Sensibilität.
Wie verhalte ich mich bei Familien-Stereotypen?
Erlebnisse
- In Kindergartenbüchern folgen Familien ausschließlich heterosexuellen Lebensmodellen. Regenbogenfamilien, lesbische oder schwule Elternpaare, kommen nicht vor. Bestimmte Berufe werden männlich oder weiblich gemacht, indem „typische” Vertretungen dargestellt werden, wie zum Beispiel der Handwerker, der Wissenschaftler, die Krankenschwester, die Sekretärin, oder indem berufliche Anforderungen wie Entscheidungsstärke, Körperkraft, Empathie, Geduld ein Geschlecht bekommen und in der Folge als typisch männlich oder weiblich erscheinen.
- Eine Frau aus Salzburg schreibt: „Mein Enkel wächst bei mir auf, er ist 8 Jahre und nennt mich ‚Mama‘. Ich bin mindestens 20 Jahre älter als andere Eltern seiner Klasse. Wenn ich ihn abgebe oder aufsammle, bemerken die anderen Kinder diesen Unterschied. Er sagt, sie lachen ihn aus, fragen ihn, warum seine ‚Mama‘ so alt sei.“
- Ein Mann schreibt von einer Eltern-Lehrer Konferenz an einer Grundschule: „Meine Frau und ich sind beide hingegangen, und die Lehrkraft lehnte sich zu uns und flüsterte, ‚Ich weiß das sofort, welche Kinder in meiner Klasse zwei Eltern zu Hause haben.‘ Sie meinte das sicherlich nett, aber der beste Freund unseres Sohnes wird von einer Alleinerziehenden erzogen – und die macht das sehr gut. Ich frage mich, wie die Lehrkraft wohl den besten Freund meines Sohnes in der Klasse behandelt.“
Sag was!
Familien gibt es in allen Formen und Größen. Wenn Schulen sich an einer traditionellen Definition von „Familie“ festklammern, werden sie zu einem ausgrenzenden Ort für einige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten. Der beiläufige Gebrauch von Bezeichnungen wie „kaputtes Elternhaus“ kann ungewollt Schaden anrichten. Hier sind einige Ideen um die Perspektive in Bildungseinrichtungen zu vergrößern.
Inspirationen
Arbeite mit dem Individuum. Wenn ein Kommentar fällt, der einen Typ Familie ausschließt oder schlecht redet, weise darauf hin. „Sie meinen, alle Ein-Eltern Haushalte sind schlecht?“ Oder einfacher gefragt: „Was meinen Sie damit?“ „Ich finde, alle Personen, die Verantwortung für Kinder übernehmen, verdienen Unterstützung.“ „Die Realität zeigt, dass Familien schon immer vielfältig waren. Keinerlei Einfluss auf das Wichtigste haben das Geschlecht der Eltern, deren sexuelle Orientierung, ihr Bildungsstand, ihre Ethnie oder eine Behinderung: nämlich ob das Kind glücklich und sicher aufwächst.“
Verändere. Bitte die Schulverwaltung, eine konkrete Veränderung durchzusetzen. Statt „Elternabend“, bitte die Verwaltung, den umfassenderen Begriff „Familienabend“ zu verwenden. Beantrage, dass die Formulare so geändert werden, dass viele unterschiedliche Familienarten möglich sind. Statt nur „Mutter/ Vater“ als Kontaktperson, könnten sie zum Beispiel „Erziehungsberechtigte/ Vormund“ verwenden.
Bitte um Hilfe. Wenn ein Kind in der Schule aufgrund z.B. einer unterschiedlichen Familienkonstellation eingeschüchtert, geärgert oder gemobbt wird, informiere die Schulverwaltung und suche Hilfe bei der für die Schule zuständigen Fachkraft für Sozialpädagogie oder Psychologie.
Unterstütze. Setz dich für Unterstützung und Training ein. Verbünde dich mit anderen, damit die Schulbibliothek und Lehrpläne positive Beispiele von diversen Familienstrukturen enthalten, inklusive Großeltern als Eltern, Alleinerziehenden-Haushalte, Adoptivfamilien, Pflegefamilien und Familien mit schwulen oder lesbischen Eltern. Diskutiere das Thema mit dem/ der Schuldirektion oder den Fachkräften für Sozialpädagogie. Frage nach einem Weiterbildungsangebot für Lehrende zum Thema Familien-Diversität.
Was kann ich gegen Schul-Mobbing machen?
Erlebnisse
- Eine Schülerin der Abschlussklasse, die übergewichtig ist, sagt, sie ist seit Jahren das Ziel von Einschüchterung und Hass. „Es fing in der Mittelstufe an. Einige aus meiner Klasse sagten mir, mein Leben sei nicht lebenswert und ich sollte es auf der Stelle beenden. Und das ging in der Oberstufe weiter. Kinder können echt unglaublich gemein sein. Es sind nicht nur die Erwachsenen. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand so gemein zu jemand anderem sein kann. Ich verstehe es einfach nicht.“
- Der Vater eines 14-Jährigen berichtet: „Sozialer Status ist ein Riesenthema: ‚Ach, der arme Löffel hat nur ein Smartphone der vorletzten Generation?‘ Die Schere zwischen Arm und Reich ist heftig groß geworden.“
- „Mobbing ist, wo ein kleiner Teil der Gruppe was tut, was nicht in Ordnung ist und die Mehrheit reguliert das nicht, die unbeteiligte Mehrheit protestiert nicht.“ Mutter eines betroffenen 12-Jährigen

Sag was!
Schüler*innen werden jeden Tag geärgert und gehänselt, aus allen möglichen Anlässen. Manchmal nur schon, weil sie anders sind. Wenn du selbst, oder jemand, den du magst, längere Zeit Zielscheibe von Beleidigungen oder sogar das Ziel von Hassattacken wird, solltet ihr etwas sagen.
Inspirationen
Bastle dir ein Sicherheitsnetz. Suche dir Personen, die als gerecht gelten und fair. Sprich einzeln drei-vier Personen an, ob ihnen aufgefallen ist, wenn du beleidigt wurdest. Sag zunächst nicht mehr. Wiederhole das zwei Mal nach weiteren Vorfällen. Prüfe, welche Person du für die mutigste hältst und bitte sie, beim nächsten Mal etwas zu sagen (du gehst davon aus, dass dann weitere Leute euch unterstützen). Gib den anderen den Hinweis, du wünschst dir, dass die Person eine andere unterstützt, wenn die das anspricht.
Verbünde dich. Halte dich immer nah bei Freund*innen oder Erwachsenen auf. Weise sie darauf hin, was passiert. Schüler*innen, Lehrkräfte und andere sind oft bereit, gemeinsam gegen solche Attacken zu handeln. In diesem Fall gilt: Je mehr Verbündete, desto besser.
Dreh den Spieß rum. Fange an, in Gruppen wo abwertende Bemerkungen gemacht werden, genau das als erstrebenswert darzustellen. „Wow, du nutzt dein Smartphone ja lange. Super umweltfreundlich von dir, mit den seltenen Metallen aus Konfliktzonen und so.“ „Finde ich klasse, dass du deine Kleidung aufträgst. Das ist noch ökologischer als recyceln.“
Sprich die angreifende Person an. Einige Betroffene werden dadurch stark, dass sie die Hoheit über ihre eigene Identität ergreifen. Für sie könnte eine Antwort sein „Ich mag meinen Körper so, wie er ist.“ Oder „So bin ich, und ich fühle mich wohl so.“ Wenn die Angriffe weiter gehen, übe nicht-aggressive Arten zu antworten; mache einen Hirnsturm, um clevere oder lustige Antworten zu finden.
Prüfe die Vorschriften. Hat deine Schule eine Anti-Mobbing Regel, die angewendet werden kann? Oder Anti-Hass Vorschriften, die gegen das schlechte Verhalten genutzt werden können? Wenn ja, nutze sie. Wenn nein, setze dich dafür ein, dass solche Vorschriften erlassen werden.
Denke groß. Mobbing ist ein System, das nicht von einer Einzelperson gelöst werden kann. Suche andere, die darunter leiden, suche dir Erwachsene, die ein Interesse haben, das System zu ändern. Zentral bei euren Überlegungen sollte sein: Wie kann sichergestellt werden, dass Regeln zum freundlichen Umgang dauerhaft angewandt bleiben?
Starte eine Kampagne. Siehe dazu der Teil „Sag Was! Als Kampagne“. Durchsuche das Internet, welche Quellen für Hilfe du findest. Du könntest mit HateAid starten.
Bleib dran. Papier ist geduldig, Marketing-Bildchen spiegeln nicht die Realität wider? Werden vorhandene Regeln nicht durchgesetzt, oder verbessert sich die Situation nicht, weise die Vertrauenslehrkraft oder Fachkraft für Soziologie oder Psychologie der Schule darauf hin. Erarbeitet gemeinsam, was bis wann passieren soll und ob ihr andernfalls lokale Journalist*iInnen einbinden wollt. Ihr könnt Beispiele suchen, was andere Schulen machen und wie das dort umgesetzt wird.
Wie verhalte ich mich bei Ausgrenzungen in meiner eigenen Gruppe?
Erlebnisse
- Von einer 20-jährigen afrikanisch stämmigen Studentin aus Leipzig: „Ich bin mein ganzes Leben ‚Oreo‘ genannt worden ‚Du bist außen schwarz und innen weiß.‘ oder ‚Du bist aber weiß!‘“
- Eine deutsch-spanische Schülerin bekommt mittags in ihrer Clique gesagt „Du bist zu deutsch!“
- Einige Spätaussiedler aus Russland schildern, dass sie von anderen Gleichen „zu deutsch“ genannt werden. Und einige Latinos von anderen Latinos „zu ethnisch“ genannt werden. Ähnlich werden einige Homosexuelle von anderen Homosexuellen als „zu weiblich“ oder „zu schwul“ betitelt.
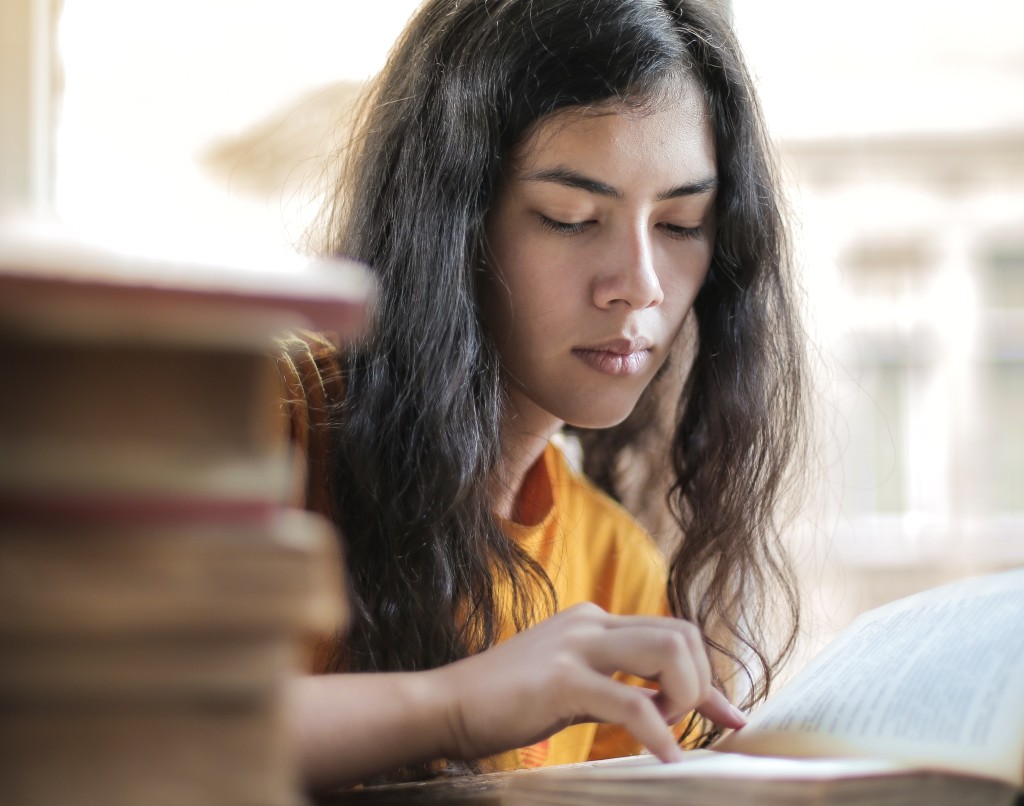
Sag was!
Wir suchen uns oft Gruppen von Leuten, die uns ähnlich sind, damit wir eine Pause bekommen von den alltäglichen Herabsetzungen, die durch Rassismus, Homophobie oder Ethno-Zentrismus etc. entstehen. Wenn Vorurteile aus unserer eigenen Gruppe kommen, kann das besonders schmerzlich und verwirrend sein.
Inspirationen
Bekräftige deinen Stolz. „Ich bin stolz afrikanisch stämmig zu sein, war es immer, werde es immer sein.“
Antworte mit einer Frage. Fordere die Stereotypen im Denken heraus, wie du es bei jeder anderen Gruppe tun würdest. „Was meinst du denn mit ‚zu ethnisch‘? Verstehe nicht, was du meinst.“ oder „Wo fängt ‚zu ethnisch‘ an und hört ‚nicht ethnisch genug‘ auf?“
Suche die Wurzel. Viele gruppen-internen Angriffe sind Weiterverbreitungen erlebter rassistischer oder sexistischer Stereotypen. Weise darauf hin, dass Angriffe von „zu feminin“ oder „zu männlich“ genau diese Homophobie und diesen Sexismus stärken, der sich gegen beide richtet. Alles, was ein Gruppenmitglied verletzt oder ausgrenzt, verletzt oder grenzt in Wirklichkeit alle Mitglieder dieser Gruppe aus.
Wie gehe ich mit Vorurteilen der Lehrenden um?
Erlebnisse
- Eine 18-Jährige ist eine der wenigen jüdischen Schüler*innen einer großen Schule in Berlin. „Eines Tages im Chemie-Unterricht haben wir mit dem Lehrer verhandelt, weil wir am nächsten Tag keinen Chemietest wollten. Ich hatte 50 Cent in der Tasche und sagte ‚Ich zahle Ihnen 50 Cent, wenn Sie uns morgen keinen Test aufgeben.‘ Ein Schüler weiter hinten sagte ‚50 Cent ist viel Geld für einen Juden.‘ Die junge Frau sagt, der Lehrer hat sie später auf Seite genommen und ihr gesagt, dass der Kommentar des Schülers nicht akzeptabel war. Sie wünscht sich, der Lehrer hätte das vor der ganzen Klasse gesagt, sodass alle es gehört hätten.“
.
- Zwei Lehrkräfte, eine weiß, eine asiatisch-stämmig, stehen im Schulflur. Die weiße Lehrkraft schaut angewidert zum anderen Ende des Flures, wo türkisch-stämmige Schüler*innen stehen, und sagt über die Gruppe bezogen auf die Herkunft „Diese Schüler*innen stören immer.“ Die asiatisch-stämmige Lehrkraft sagt nichts. Wie soll sich die asiatisch-stämmige Lehrkraft verhalten?
- Der Schuldirektor hat beim Verteilen der Abschlusszeugnisse Schwierigkeiten, kambodschanische und vietnamesische Namen auszusprechen. Er lacht „es ist so schwierig, diese ausländischen Namen auszusprechen.“ Lehrkräfte, die sich bemüht haben, die Namen richtig auszusprechen, fragen sich, was sie dem Direktor sagen sollen.
Sag Was!
Lehrkräfte und die Schulverwaltung spielen eine wichtige Rolle, den Ton im Schulleben zu setzen. Wenn diese Führungskräfte Intoleranz statt Respekt vorleben oder stillschweigend akzeptieren, werden Schüler*innen ausgegrenzt und es wimmelt von Vorurteilen.
Inspirationen
Betone das Vorbild. Wenn eine Lehrkraft oder Verwaltungskraft kein gutes Beispiel gibt – oder sogar ein schlechtes Beispiel setzt – sprich diese Person in ihrer sichtbaren wichtigen Rolle an, um Veränderungen durchzusetzen. „Sie sind die Lehrkraft. Leute schauen zu Ihnen auf als Beispiel, wie es sein sollte. Wenn Sie nichts sagen, wird niemand wissen, dass es falsch ist, solche Dinge zu sagen.“
Schule soll bilden. Fordere die Lehrkraft auf, den vorurteils-beladenen oder respektlosen Kommentar zu überdenken: „Diese Schule will alle Lernenden mit einer Bildung versorgen, in einer sicheren und offenen Umgebung. Dies müssen wir honorieren.“
Biete Hilfe an. Verhalte dich so, was du für ein gutes Verhalten hältst. Biete denen, denen es schwer fällt, deine Hilfe an. „Ich habe lange gebraucht, bis ich die Namen meiner Schüler*innen korrekt aussprechen konnte. Gerne helfe ich Ihnen dabei, sie korrekt auszusprechen.“
Vielleicht magst du in anderen Themen stöbern, ob du dort Inspirationen findest, die gut auf deine Situation passen?
Weiter zum Thema “Arbeit”
